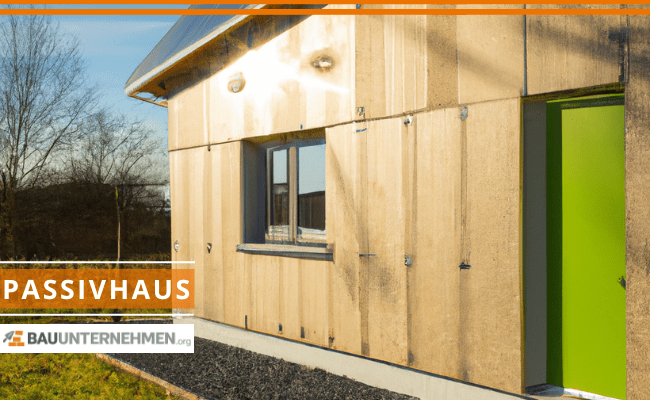Das Passivhaus ist ein Baukonzept, das zukünftig immer mehr Bedeutung erlangen sollte. Denn es benötigt zum Heizen von Räumen keine Verbrennungssysteme wie Öl-, Holz-, oder Gasheizungen. Dadurch macht es Bauherrn etwas unabhängiger von Energiekosten und schont die Umwelt.
Alles auf einen Blick
- Ein Passivhaus ist keine Bauart, sondern ein Baukonzept.
- Es nutzt die Außenluft nicht nur zur Lüftung des Wohnraumklimas, sondern die Abluft auch als Heizung und zur Kühlung.
- Die Lüftungsanlage zur Wärmerückgewinnung ist das Herzstück.
- Damit das Konzept funktioniert, benötigt ein Haus besondere Fenster und Türen sowie eine hochwirksame Wärmedämmung, die wie eine Gebäudehülle wirkt.
- Die Vorteile sind: Sinkende Energieausgaben, ein nachträglicher Schutz der Bausubstanz, im Vergleich zum Niedrigenergiehaus niedriger Energieverbrauch und trotz umfassender Dämmungsmaßnahmen günstiger als Nullheizenergiehäuser.
Definition und Anforderungen
Ein Passivhaus ist eine gute Möglichkeit, um sich unabhängiger von steigenden Preisen für Energie zu machen. Es ist allerdings keine Bauart, sondern ein Konzept. Die Anforderungen für Passivhausstandards unterliegen strengen Normen.
Was ist ein Passivhaus?
Die Definition des zertifizierten Passivhausinstitut Darmstadt (PHI) lautet wie folgt: „Ein Passivhaus ist ein Gebäude, in welchem die thermische Behaglichkeit nach ISO 7730 allein durch Nachheizen oder Nachkühlen des Frischluftvolumenstroms, der für ausreichende Luftqualität nach DIN 1946 erforderlich ist, gewährleistet werden kann – ohne dazu zusätzlich Umluft zu verwenden.“
Das Passivhaus ist keine Bauweise oder, wie oftmals gleichgesetzt, nur ein Energiesparhaus. Es ist ein ganzheitliches Konzept. Dieses ermöglicht, dass das Gebäude nur mithilfe von Frischluft erwärmt und gekühlt wird. Eine Heizung mit Öl, Gas oder Holz ist nicht notwendig. Daher erlaubt es Bauherrn, ein qualitativ hochwertiges, nachhaltiges und zugleich bezahlbares Gebäude zu errichten.
Diese Häuser lassen sich für nahezu alle Formen bauen – von Wohn- und Bürogebäuden, Schulen, Kindergärten über Sporthallen, Pflegeheimen bis hin zu Fabrikgebäuden. Auch die Bauweise spielt keine Rolle. Ob Mauerwerks-, Holz-, Stahl- oder Mischbau: Alles ist möglich.
Seinen Namen hat das Konzept durch die passiven Maßnahmen, die die thermische Behaglichkeit, also den Wohnkomfort gewährleisten. Dazu zählen die Wärmedämmung, die Wärmerückgewinnung und die passiv genutzten Wärmequellen, wie die Sonne oder der Mensch.
Welche Anforderungen gibt es?
Damit ein Passivhaus in Mitteleuropa als solches deklariert wird, muss es die Passivhausstandards im Sommer wie Winter erfüllen. Dazu zählen:
- Heizwärmebedarf: Der Wärmedurchgangskoeffizient für Außenbauteile, auch U-Wert genannt, muss jährlich unter 0,15 Watt die Stunde pro Quadratmeter liegen. Der U-Wert für Fenster darf 0,8 Watt die Stunde pro Quadratmeter nicht überschreiten.
- Heizlast: Die Heizlast muss unter 10 Watt pro Quadratmeter liegen.
- Energie: Der Primärenergiebedarf darf 120 Kilowatt die Stunde pro Quadratmeter und Jahr nicht überschreiten. Zudem sind nicht mehr als 60 Kilowatt die Stunde pro Quadratmeter und Jahr für den Bedarf an erneuerbarer Primärenergie für die Heizung, Strom und Warmwasseraufbereitung zugelassen.
- Luftdichtheit: Der Wert der Luftdichtheit, der das Durchströmen durch Fugen und Ritzen einer Gebäudehülle angibt und per Blower-Door-Test gemessen wird, muss n = 0,6 pro Stunde bei 50 Pascal betragen. Gesetzlich ist in Gebäuden mit Lüftungsanlagen der Wert 1,5 erlaubt.
- Zuluft: Die Zuluft am Luftauslass im Raum darf nicht weniger als 17 Grad Celsius betragen und eine Durchströmung aller Räume muss möglich sein.
Zudem ist es sinnvoll, Wärmebrücken durch entsprechende Planung und Bauweise zu verhindern.
Funktionsweise
Zwei Prinzipien sind wichtig, damit ein Passivhaus funktioniert: Alle Wärmeverluste sind so weit wie möglich zu vermeiden und alle Möglichkeiten der Wärmegewinnung auszuschöpfen. Dafür sind eine gute Dämmung mittels energieeffizienter Bauteile und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung notwendig. Um auf die klassischen Heizungen zu verzichten, bedient sich das Konzept der Außenluft, die die Räume auf Temperatur bringt.
Wie funktioniert ein Passivhaus?
Früher wurde nicht viel Wert auf Dämmung gelegt, heutige Neubauten sind meist sehr gut gedämmt. Aufgrund der Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG gelangt keine oder wenig Luft vom Raum über Ritzen und Fugen nach außen. Der Nachteil dabei: Sie müssen Fenster öffnen, um frische Luft in die Räume zu bekommen.
Hier setzt das Passivhaus an. Denn es hat nicht nur eine gebäudeumfassende Wärmedämmung, sondern auch eine autarke Lüftung, die Wohnungslüftung. Dabei nutzt das Konzept die frische Außenluft, um diese auch als Heizelement zu nutzen. Mittels Wärmerückgewinnung aus der Abluft des Raums sorgt die Lüftungsanlage für Wärme im Winter. So gibt es stets frische Luft für ein gesundes Leben – für Mensch und Mauerwerk des Hauses.
Für den Lüftungsprozess zieht die Wohnraumlüftung die Frischluft von außen an, die im Wärmetauscher durch die abfließende Abluft erwärmt wird. Bis zu 80 Prozent der Abluftwärme können an die Zuluft abgegeben werden. Zudem nutzt das Konzept die hausinneren Energiequellen wie Sonnenwärme oder Körperwärme und sorgt für angenehme Temperaturen und einen erhöhten Wohnkomfort, auch als thermische Behaglichkeit bekannt.
Eine klassische Heizungist nicht vorhanden. Natürlich gibt es in solchen Häusern dennoch die Möglichkeit der zusätzlichen Heizung bei sehr kalten Temperaturen und zur Warmwasseraufbereitung, beispielsweise durch Solarenergie.
Im Sommer dient die Lüftung als Klimaanlage– ohne zusätzliche Kanäle oder Ventilatoren. Dadurch lassen sich die Kosten für ein weiteres Gerät sparen, denn normalerweise müssten Sie für eine Lüftungsanlage den gleichen Betrag wie für eine Heizung anberaumen.
Dieses Konzept der Frischluftheizung ist allerdings nur in einem gut gedämmten Haus mit geringem Wärmeverlust möglich. Dafür bedarf es eines guten Wärmeschutzes der Gebäudehülle durch besondere Türen und Fenster sowie an den Außenwänden, Dach und Fundament. Wie hoch der individuelle Wärmeschutz ausfallen muss, lässt sich mit der Energiebilanz ausrechnen.
Vorteile und Nachteile
Das Konzept des Passivhauses bietet viele Vorteile. Vor allem ist der Heizwärmebedarf geringer als bei herkömmlichen Gebäuden, womit sich Energiekosten sparen lassen und zugleich der Wohnkomfort nicht darunter leidet. Zu den Nachteilen zählen viele Menschen die erhöhten Anschaffungskosten, die sich allerdings durch die alltägliche Energieersparnis amortisieren lassen.
Was sind die Vorteile?
- Heizkosten: Die Passivhausstandards sorgen für einen niedrigen Energieverbrauch. 1,5 Liter Heizölgleichwert je Quadratmeter verbraucht ein solches Gebäude – und damit weit weniger als ein Niedrigenergiehaus. Aus der Abluft lässt sich durch die Wärmerückgewinnung bis zu 80 Prozent der Heizwärme einsparen.
- Wohnkomfort: Ein nach Passivhausstandards gebautes Gebäude nutzt die hausinneren Energiequellen wie die Wärme der Sonnenstrahlen und der Menschen, um für angenehme Temperaturen und einen etablierten Wohnkomfort zu sorgen – im Sommer wie im Winter.
- Anschaffungskosten: Im Vergleich zu den Nullheizenergiehäusern, die einen ähnlichen Aufwand für die Dämmung erfordern, sind die Passivhäuser günstiger und damit bezahlbarer. Keine Wärmebrücken: Die Dämmung wird ohne Schwachstellen an Fenstern um das gesamte Gebäude gelegt, sodass keine Wärmebrücken entstehen. Die Wärme im Raum kann nicht entweichen, es kommt zu keinen kalten Stellen und damit auch nicht zur Gefahr von Schimmelbildung.
- Gesetz: Ab 2020 müssen Neubauten nach einem Beschluss des europäischen Parlaments und Rats so konstruiert werden, dass sie keine nicht-erneuerbaren Energien verbrauchen. Dieser Gebäude sind auch als nearly zero energy buildings bekannt. Das Passivhaus ist hierfür perfekt geeignet.
- Sicherheit: Durch die geringere Menge an gelagertem Brennstoff sinkt auch die Brand- und Explosionsgefahr im Haus.
Welche Nachteile sind zu beachten?
- Zusätzliche Investitionen: Neben den Dämmungskosten fällt auch ein Betrag für die Lüftung an – gleichbedeutend mit bis zu 15 Prozent Mehrausgaben. Allerdings lassen sich die Kosten für den Bau eines solchen Hauses durch staatliche Förderprogramme wie dem KfW-Effizienzhaus 55 abfedern. Zudem senken Lüftungsanlagen mit Passivhausqualität den täglichen Energieverbrauch deutlich.
- Kein Lüften: Aufgrund der Lüftungsanlage erfolgt eine dauerhafte Luftzirkulation im Haus. Ein Öffnen der Fenster untergräbt die Funktion, ist kontraproduktiv und kann zusätzliche Energie kosten.
- Bauweise: Für die Wärme der Sonnenstrahlen im Raum werden oft möglichst viele Fenster mit Blick nach Süden gebaut. Im Sommer führt das allerdings zu höheren Temperaturen, was eine höhere Beanspruchung der Lüftungsanlage zum Kühlen bedeutet. Um diesen Effekt zu mindern, bedarf es Jalousien oder getönter Fenster.