Dienstbarkeiten bezeichnen Nutzungsrechte gegenüber fremden Sachen. Wer beispielsweise ein fremdes Grundstück überqueren muss, um zu einem Ort zu gelangen, muss eventuell eine Dienstbarkeit bestellen, die sein Recht absichert. Das BGB unterscheidet vier verschiedene Arten: Die Grunddienstbarkeit, die beschränkte persönliche Dienstbarkeit, den Nießbrauch sowie das Dauerwohnrecht.
Definition: Was ist eine Dienstbarkeit?
Eine Dienstbarkeit wird im Grundbuchamt in das Grundbuch vermerkt. Dazu muss der Eigentümer die Eintragung in notariell beglaubigter Form bewilligen.
Es gibt verschiedene Anwendungsbereiche. Je nachdem, um welche es sich handelt, kommt eine andere Art der Dienstbarkeit zum Tragen. Die Grunddienstbarkeit setzt ein, wenn rechtliche Beziehungen zwischen Nachbarn geregelt werden müssen. Das sind Überfahrt- und Wegerechte, aber auch Leitungsrechte für Abwasser. Hauptsächlich kommt sie jedoch für Wettbewerbsbeschränkungen zum Einsatz. So kann sich zum Beispiel ein Eigentümer eines Grundstücks verpflichten, dort keine Gaststätten zu betreiben oder von jemand anderem führen zu lassen. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit findet im BGB konkret in § 1093 Erwähnung. Das Wohnungsrecht beispielsweise erlaubt es einem Elternteil, das Familienwohnhaus an den Sohn zu verkaufen, sich jedoch das Recht eintragen zu lassen, es lebenslang bewohnen zu dürfen.
Das deutsche Sachenrecht sieht vor, dass alle Arten von Dingen mit Dienstbarkeiten belastet werden können. Darunter fallen Kraftfahrzeuge, Forderungen, Konzessionen, Grundstücke, aber auch grundstücksgleiche Rechte. Je nach Fall wird hier die Dienstbarkeit bestimmt. Bei beweglichen Sachen findet keine Grunddienstbarkeit Anwendung, bei Grundbesitz darf jede Art der Dienstbarkeit angesetzt werden.
Arten von Dienstbarkeiten
Die Dienstbarkeit leitet sich aus dem dinglichen Recht ab. Beschränkte dingliche Rechte sind in Deutschland vom Eigentum abgespaltet. Sie sorgen dafür, dass der Rechtsinhaber nur einen limitierten gesetzlichen Zugang zur Sache hat. Damit sind sie Belastungen des Eigentums und erteilen einem Dritten die Befugnis, es zu nutzen, zu verwerten oder zu erwerben. Dienstbarkeiten unterscheiden sich von Nutzungsverträgen, die schuldrechtliche Vereinbarungen darstellen und nicht eintragungsfähig sind. Anders als Dienstbarkeiten gelten Nutzungsrechte nur zwischen den Vertragsparteien und wirken nicht gegenüber einem Rechtsnachfolger.
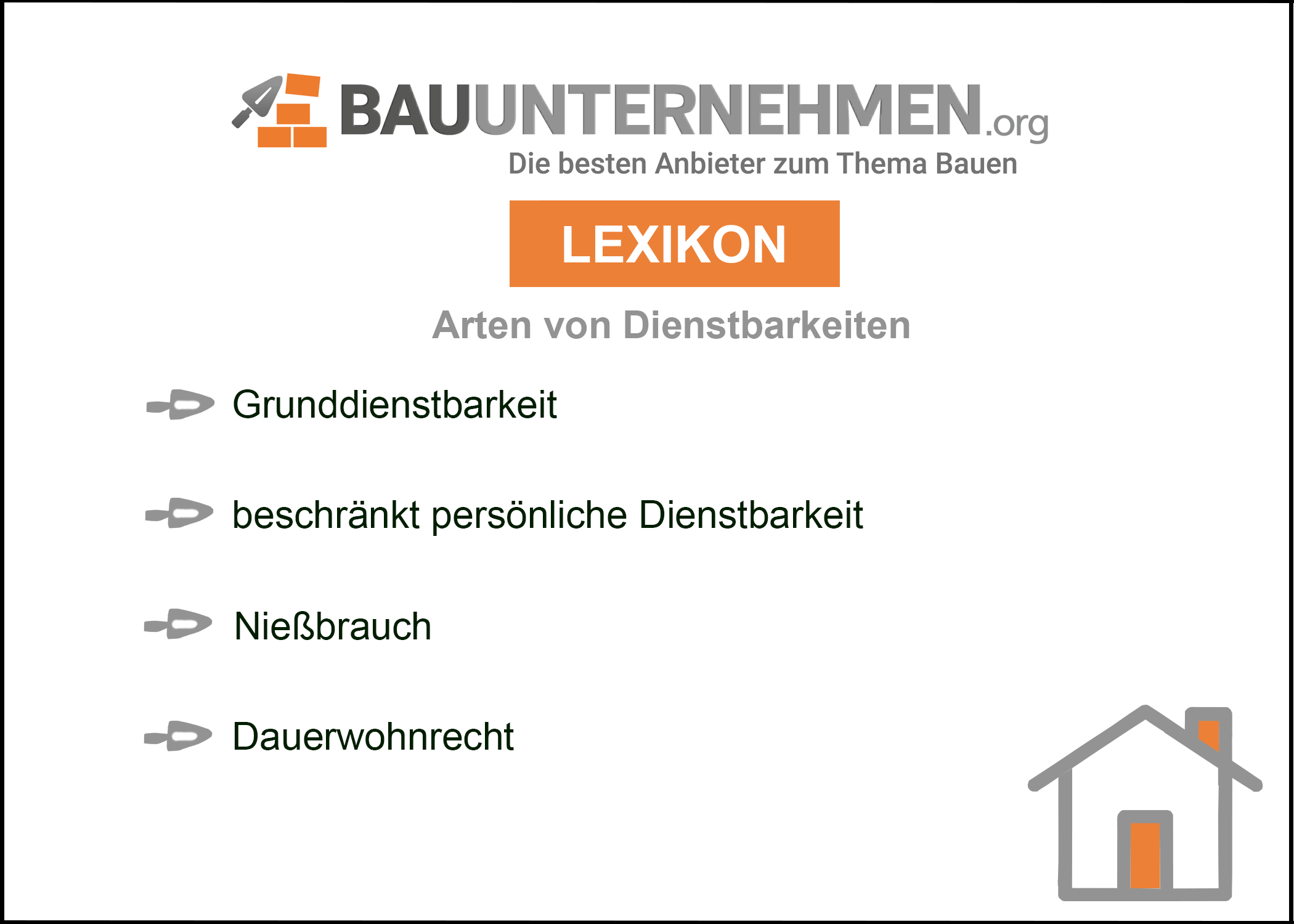
Man unterscheidet:
– die Grunddienstbarkeit,
– die beschränkt persönliche Dienstbarkeit,
– den Nießbrauch sowie
– das Dauerwohnrecht
Die Grunddienstbarkeit
Die Grunddienstbarkeit belastet ein dienendes Grundstück zugunsten des Eigentümers eines fremden, herrschenden Anwesens. Der Eigentümer erhält Geh-, Fahrt-, Leistungs-, oder Verbotsrechte. Letztere beinhalten die bereits erwähnten Wettbewerbsbeschränkungen, wie die Einrichtung eines Restaurants. Anders als das Nutzungsrecht und der Nießbrauch erlaubt die Grunddienstbarkeit nur Einzelnutzungen des Anwesens und schließt bestimmte Handlungen oder Rechte aus. Sie wird durch die Einigung der Eigentümer besiegelt und ins Grundbuch des belasteten Anwesens eingetragen. Überträgt der Besitzer das jeweils dienende oder herrschende Grundstück, geht das Nutzungsrecht über.
Die beschränkt persönliche Dienstbarkeit
Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit erteilt einem Rechtssubjekt die Befugnis, ein mit ihr belastetes Grundstück in einzelnen Beziehungen zu nutzen. Sie entsteht durch die Einigung zwischen Eigentümer und Berechtigtem, welche durch eine notariell beglaubigte Eintragung ins Grundbuch rechtlich festgesetzt wird.
Vom Nießbrauchrecht unterscheidet die beschränkte persönliche Dienstbarkeit, dass sie die Grundstücksnutzung auf einzelne Punkte reduziert. Anders als bei der Grunddienstbarkeit, steht die beschränkte persönliche Dienstbarkeit einer festgelegten Person und nicht dem Eigentümer des Grundbesitzes zu.
Der Nießbrauch
Der Nießbrauch ist ein umfassendes Nutzungsrecht. Er ist nicht vererblich und damit ein absolutes Recht. Er regelt nach § 100 BGB die Benutzung einer fremden Sache, eines Rechts oder eines Vermögens. Eltern können sich darüber lebenslang sichern, in einer Immobilie zu wohnen, die sie an ihre Kinder verkauft haben. Anders als bei der Grunddienstbarkeit, darf der Nießbraucher die Sache umfassend nutzen. Der Eigentümer gibt ihm die Rechte zur Nutzung und Fruchtziehung ab. Das Verfügungsrecht bleibt ihm jedoch bestehen. Das Eigentum ist vom Nießbrauch unberührt, eine Übertragung desselbigen findet nicht statt.
Das Dauerwohnrecht
Auch ein Dauerwohnrecht kann auf der nicht übertragbaren und nicht vererblichen Form der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit gründen. Andernfalls kann es als Dauerwohnrecht nach dem Wohnungseigentumsgesetz, genauer gesagt dem Dauernutzungsrecht, geltend gemacht werden. Dann ist es sowohl veräußerlich, als auch vererblich. Es berechtigt zu jeder Art von Nutzung der Wohnung, auch zur Vermietung. Das dingliche Dauerwohnrecht unterscheidet sich vom schuldrechtlichen Mietverhältnis, da es nicht gekündigt werden kann. Vor allem gemeinnützige Baugenossenschaften wenden es an.
Rechtliche Grundlagen
Die Dienstbarkeit ist in Deutschland im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Im deutschen Sachenrecht ist es möglich, alle Dinge mit dieser Ermächtigung zu belasten.
Ein solches Nutzungsrecht entsteht durch die Einigung zweier Parteien und der Eintragung ins Grundbuch. Als Unterlagen sind der Antrag, die Bewilligungserklärung und der Lageplan erforderlich. Letzterer zeigt den Verlauf der Nutzungsrechte auf dem Grundstück, ist jedoch nicht notwendig, wenn es im Zuge von Nießbrauch komplett betroffen ist. Die Kosten werden durch den Wert bestimmt, den das Anwesen für die berechtigte Person hat. Die Höhe ergibt sich aus § 34 des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG), in der die Kosten exakt aufgeschlüsselt sind.
Eine Tabelle über das Gesetz der Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare finden Sie hier.
Internationale Anwendung
Staaten, deren Gesetze auf römischem Recht beruhen, weisen ähnliche Regeln auf wie Deutschland. Als Beispiele können Österreich, die Schweiz, Frankreich und Polen gelten.
In Österreich ist die Dienstbarkeit, dort auch Servitut genannt, im Sachenrecht verankert und über den §§ 472 ff. des ABGB geregelt.
Die Schweiz unterscheidet zwischen Personal- und Grunddienstbarkeiten sowie dem Popularservitut. Erstere bestehen aus regulären und irregulären Personaldienstbarkeiten. Zu den gebräuchlichen gehört die Nutznießung, zu den atypischen das Quellenrecht. Das Popularservitut regelt eine Dienstbarkeit zugunsten der Öffentlichkeit. Dazu gehört die Benutzung von Fuß- und Fahrwegen. Die rechtliche Grundlage ist der Art. 730 ff. ZGB.
Frankreich regelt Dienstbarkeiten im Art. 690 ff. des Code Civil. Zu erwerben sind sie durch Eigentum oder Besitz. Das polnische Sachenrecht unterscheidet zwischen der Grunddienstbarkeit, der persönlichen Dienstbarkeit und der Leistungsdienstbarkeit.

