Eine Baugenehmigung erteilt laut dem öffentlichen Baurecht einem Bauherrn die Berechtigung, ein Gebäude zu errichten, es zu modifizieren oder zu entfernen. Sie wird von einer Bauaufsichtsbehörde ausgesprochen und impliziert, dass dem Bauvorhaben keine Vorschriften widersprechen. Ein Bau ohne Baugenehmigung kann neben hohen Geldstrafen zum Abriss des Gebäudes führen.
Baugenehmigung: Begriffserklärung
Die Genehmigung erteilt eine Bauaufsichtsbehörde zeitlich befristet und mit Auflagen. Sie muss auf der Baustelle jederzeit verfügbar sein. Bevor sie erteilt wird, stellt der Bauherr den Bauantrag. Mit diesem erfragt er die Baugenehmigung für sein Vorhaben, unabhängig davon, ob es um einen Neubau oder um Nutzungsänderungen geht.
Der Bauantrag geht bei kreisangehörigen Gemeinden, genauer gesagt bei deren Landratsamt ein. Die untere Bauaufsichtsbehörde entscheidet über die Erteilung der Genehmigung. Kreisfreie Städte, große Kreisstädte und bestimmte größere Gemeinden fungieren sogar selbst als Bauaufsichtsbehörde.
Der Bauantrag muss mit allen vorgeschriebenen Formularen erfolgen. Die Baubeschreibung und der Lageplan müssen dreifach eingereicht werden. Des Weiteren müssen auch folgende Dokumente eingereicht werden:
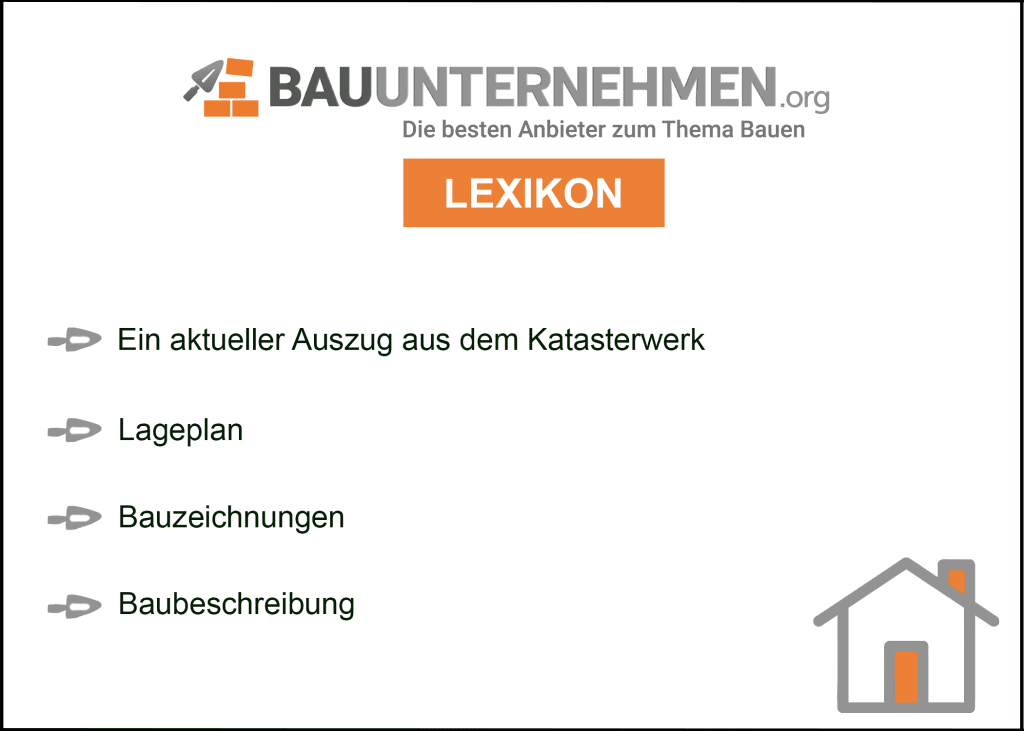
Handelt es sich um Sonderbauten, ist ein Nachweis der Standsicherheit zu erbringen. Sollte das Bauvorhaben nicht an die öffentliche Versorgung angeschlossen werden können, weist der Bauherr überdies die verkehrsmäßige Erschließung und den Brandschutz sowie die Versorgung mit Wasser, Energie und die Abwasserentsorgung nach.
In zweifacher Ausführung vorzulegen sind die statischen Berechnungen, die Konstruktions- und Bewehrungspläne sowie der Nachweis für den Wärme- und Schallschutz. Der Erhebungsbogen für die Bautätigkeit benötigt lediglich eine Ausführung. In Einzelfällen legt der Bauleiter weitere erforderliche Unterlagen vor.
Ist die Baugenehmigung erteilt, reicht der Bauherr bei der Bauaufsichtsbehörde die Anzeigen über den Baubeginn und die Nutzungsaufnahme sowie die Bautätigkeitsstatistik ein. Erstere legt der Verantwortliche mindestens eine Woche vor dem Baubeginn fest, bei Bedarf gemeinsam mit dem Kriterienkatalog, dem Nachweis der Standsicherheit, dem Brandschutznachweis und der Bestimmung für die Bauausführung. Die Anzeige der Nutzungsaufnahme gibt er mindestens zwei Wochen vor dem Baubeginn ab – gegebenenfalls mit dem Standsicherheits- und dem Brandschutznachweis. Eine erteilte Baugenehmigung wird ungültig, sollte der Bauleiter – ab dem Zeitpunkt der Genehmigung – innerhalb von ein bis vier Jahren nicht mit dem Bau beginnen oder die bereits begonnenen Arbeiten für mehr als vier Jahre unterbrechen. Die genauen Fristen variieren je nach Bundesland. Der Bauherr kann die Frist um bis zu zwei Jahre verlängern. Dazu stellt er vor dem Ablauf der Geltungsdauer der Baugenehmigung einen Antrag bei der Bauaufsichtsbehörde.
Wie lange dauert die Erteilung einer Baugenehmigung?
Die Bearbeitung der Genehmigung dauert mehrere Wochen bis Monate. Je nach Bundesland kostet sie im Schnitt 25 Promille der Baukosten. Kostet der Bau eines Hauses also beispielsweise 500.000 Euro, so würden die Kosten für die Genehmigung 12.500 Euro betragen. Um Zeit zu sparen, gibt es die Möglichkeit, Bauanträge elektronisch über das Internet einzureichen. Zuständig ist die jeweilige Aufsichtsbehörde, wie beispielsweise die Stadt München: www.buergerserviceportal.de/bayern/muenchen/bsp_muenchen_bauantrag
Der Bau sollte nicht beginnen, bevor die zuständige Behörde die Baugenehmigung erteilt hat. Sollte es sich um ein verfahrensfreies Bauvorhaben handeln, darf der Bauherr umgehend mit den Arbeiten beginnen und muss die Bauaufsichtsbehörde nicht davon unterrichten. Ist eine Baugenehmigung erforderlich und erteilt, sollte der Bauleiter Folgendes beachten:
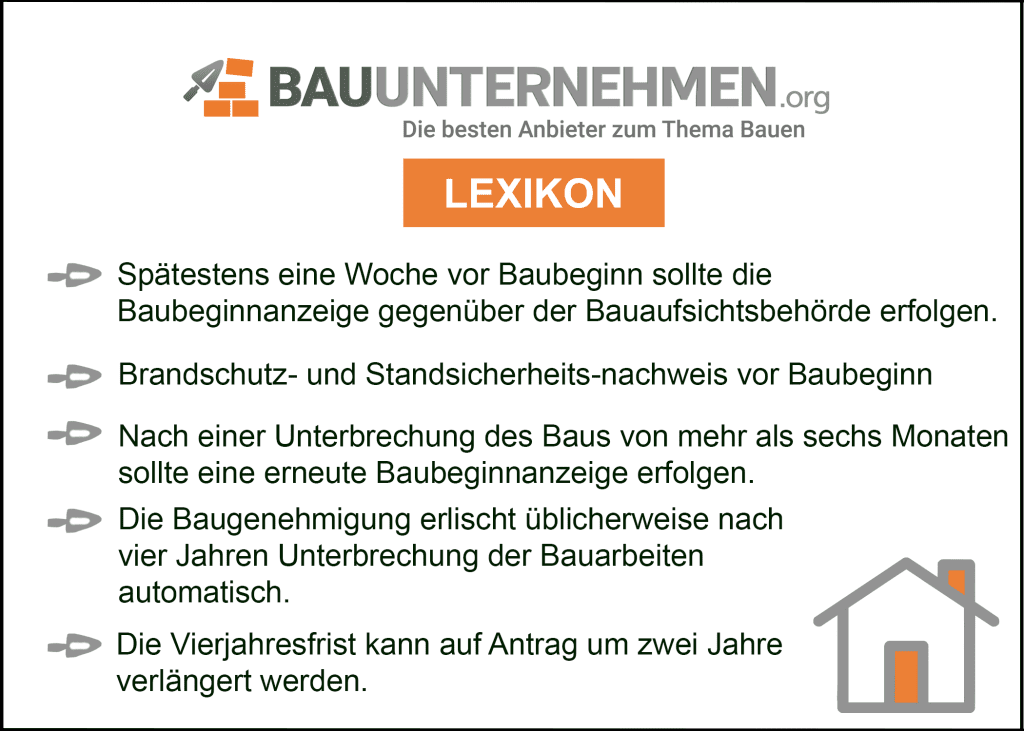
Rechtliche Grundlagen zur Baugenehmigung
Grundsätzlich kann ein Bauherr das Recht auf die Erteilung einer Baugenehmigung einklagen, sollte sie abgelehnt werden. Die zuständige Behörde muss die Entscheidung für oder gegen eine Genehmigung auf einer Rechtsgrundlage treffen und kann sie nicht nach eigenem Ermessen aussprechen. Sofern er die rechtlichen Vorgaben erfüllt, hat jeder Grundstückseigentümer das Recht zu bauen. Das erkennt die gesetzlich gewährleistete Baufreiheit an. Je nach geplantem Bau hat der Bauleiter sich an das landesspezifische Sonderbaurecht zu halten, das für Gebäude besonderer Art und Nutzung gilt. Hierzu gehören Bauten, die nicht zur Wohnnutzung gedacht sind, wie beispielweise Garagenanlagen, Schulen oder Versammlungsstätten.
Alle Bauvorhaben, die keine Sonderbauten sind, können mittels des „vereinfachten Verfahrens“ geprüft werden. Dadurch konzentriert sich die Prüfung auf das Planungsrecht und ist somit schneller durchführbar. Ebenfalls zeitsparend wirkt sich eine Bauvoranfrage aus. Über sie klärt ein Bauherr im Vorfeld, ob ein Grundstück bebaut werden darf. Sie bietet sich für Grundstücke an, für die es keinen Bebauungsplan gibt. Es empfiehlt sich, die Bauanfrage vor dem Grundstückskauf beim zuständigen Bauordnungsamt zu stellen.
Die Baugenehmigung selbst ist grundsätzlich immer dann erforderlich, wenn ein Bau errichtet, geändert, in seiner Nutzung verändert oder abgebrochen wird. Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften variieren je nach Bauordnungsamt. Sind sie erfüllt, ist das Vorhaben genehmigungsfähig. Bestimmte bauliche Anlagen, wie kleinere Wohngebäude in Plangebieten, sind vielerorts von der Genehmigungspflicht freigestellt und können über ein Bauanzeigeverfahren realisiert werden. Sie unterliegen der Genehmigungsfreiheit.
Trotzdem müssen bau- oder nachbarrechtliche Vorschriften weiterhin beachtet werden. Auch nach Jahrzehnten kann die zuständige Behörde noch die Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes verlangen. Auch im Falle einer erteilten Baugenehmigung gibt das zuständige Amt nicht nur die Erlaubnis, sondern führt auch die Bauabnahme durch. Nach der Fertigstellung wird also geprüft, ob alle Vorgaben eingehalten wurden.
Führt der Bauleiter ein Vorhaben ohne Baugenehmigung durch, oder verstößt gegen das Bauordnungsrecht, drohen Bußgelder und sogar der Abriss des Baus. Meist liegen Geldstrafen für Gebäude unter 100 Quadratmetern zwischen 100 und 25.000 Euro. Größere Projekte ziehen Geldbußen bis zu 50.000 Euro nach sich. Eine bereits erteilte Baugenehmigung wird nach einer üblichen Frist von ein bis vier Jahren ungültig. Sie variiert nach der jeweiligen Landesbauordnung und kann bei Bedarf verlängert werden. Es ist möglich, Baugenehmigungen nachträglich zu erhalten, sollte sich der Bau als vorschriftskonform erweisen. Es gilt jedoch stets das aktuelle Baurecht und nicht der Stand zu Baubeginn.
Ein Verfahrensfehler, der die Baugenehmigung verhindert, führt zu einer kompletten Neuansetzung des Festlegungsverfahrens. Wird die Genehmigung fälschlich erteilt, muss der Fehler innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden.
Prinzipiell besteht für alle Gebäude, die mit einer gültigen Baugenehmigung errichtet wurden, ein Bestandsschutz. Dieser greift erst dann, wenn ein Gebäude im Wesentlichen fertiggestellt ist. Die Bauaufsicht kann es jedoch über eine Abrissverfügung vollständig oder teilweise abreißen lassen, wenn die Bauanlage gegen die Vorschriften verstößt. Sie ist in den Bauordnungen der Länder verankert und je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Zu prüfen ist stets die Verhältnismäßigkeit, also ob der Schaden für den Gebäudeeigentümer nicht höher als der Nutzen ist, der durch den Abriss entsteht.
Bei „Schwarzbauten“, also Bauten ohne erteilte Erlaubnis, ist die Verhältnismäßigkeit unerheblich, da der Eigentümer bewusst auf eigenes Risiko gebaut hat.
Wie können Dritte die Baugenehmigung beeinträchtigen?
Ein Nachbar, der einem Bauvorhaben nicht zustimmt, kann die erteilte Erlaubnis anfechten. Dazu muss er jedoch von den Baumaßnahmen betroffen sein. Das ist beispielsweise bei der Unterschreitung von Mindestabständen zu seinem Grundstück oder Gebäude der Fall. Dann darf sich der Nachbar auf eine „drittschützende Norm“ berufen. Die Regeln für Baugenehmigungen unterscheiden sich je nach Bundesland, weshalb auch die Anfechtung individuell geprüft werden muss.
Spezialregelungen in Bayern
In Bayern dürfen Eigentümer Garagen, Carports und Terrassenüberdachungen in vielen Fällen genehmigungsfrei bauen. Keine Erlaubnis benötigen Garagen und überdachte Stellplätze mit einer Gesamtnutzfläche von bis zu 50 Quadratmetern, die nicht im Außenbereich liegen. Liegt ein Bebauungsplan vor und ist die Garage plankonform, ist bis zu einer Nutzfläche von 100 Quadratmetern kein Bauantrag nötig.
Auch Terrassenüberdachungen darf ein Eigentümer in Bayern ohne ein Baugenehmigungsverfahren errichten oder verändern. Dazu darf die Fläche nicht größer als 30 Quadratmeter sein und die Tiefe nicht mehr als drei Meter betragen. Größere Überdachungen müssen hingegen beim Bauamt beantragt werden.
Weiterführende Links
Bauantrag der Landeshauptstadt München


